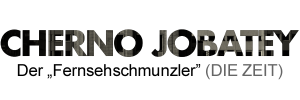Cool, John Lurie!
Studenten haben ihn überm Küchentisch hängen, Kinogänger preisen seine Filme, Jazzmusiker ahmen ihn nach, und wenn Discjockeys ihrer tanzwütigen Kundschaft etwas wirklich Gutes tun wollen, dann legen sie eine seiner Platten auf. Es gibt viele Arten, dem New Yorker Ein Mann Multi Media Unternehmen John Lurie zu huldigen.
Das Multimediale kann es nicht allein sein, was ihn zum Kultstar gemacht hat, denn das ist nicht ungewöhnlich: Seit der Punkrevolution gibt es in der Subkultur nichts wirklich Neues mehr, alles wird nur wieder neu aufbereitet. Beim „kreativen“ Blick zurück werden dann meist mehrere Ausdrucksformen erfasst, aufgenommen und übernommen: Das trifft zu auf den Talking Head David Byrne mit seinen Filmen, Woody Allen, der Klarinette in einer Jazzband spielt, Prince, Brian Eno bis hin zu BAP Sänger Wolfgang Niedeggen, der mit seinen Bildern mehr als nur Achtungserfolge erzielte.
Auch John Lurie hat in eine Schublade gegriffen. Er zog den Fünfziger Jahre Jazz daraus hervor und mit ihm die Ästhetik des „Hipsters“, den Norman Mailer 1957 im „White Negroe“ zum ersten Mal beschrieben hat. Hipsters hörten Jazz, machten Jazz, liebten Jazz, waren Jazz. Hipsters waren Schwarze, die in der Welt der Weißen überleben, erfolgreich sein und doch Schwarze bleiben wollten. Sie akzeptierten die Normen der Weißen, die sie zur Maskerade übertrieben. Sie gaben sich elegant und lässig, nichts tangierte sie. Hauptsache, sie konnten sie selbst sein und unbehelligt „ihr Ding drehen“, was es auch immer war, und dabei aufrecht bleiben.
Dieses überlegene Selbstbewusstsein faszinierte nicht nur Schwarze. Die Fitzgeralds, die Kerouacs, die Mailers, sie alle pilgerten nach Harlem, der Hipster-Hauptstadt. Irgendwann verlor der Hipster, so erkannte Mailer, seine Hautfarbe und- wurde ein allgemeines Phänomen. „Hip“, so definierte Mailer, „ist die Kultur des weisen Primitiven in einem gigantischen Dschungel Jugendliche in aller Welt fühlten sich davon angesprochen, diese Lebenshaltung war wie geschaffen für sie. Und so übernahm die weite „weiße“ Welt mit dem Jazz auch dessen Ideologie.
Die Rock n Roll Revolution in den sechziger Jahren verdrängte die Hipsters, Musik und Musiker wurden laut und brachial. Die „Hippies“ versuchten immerhin, das „Dreh dein eigenes Ding!“ wieder zu beleben. Danach galt der Hipster als ausgestorben. Der Jazz war nichts weiter als ein sportliches Hochgeschwindigkeitsrennen über Saiten, Klappen, Tasten und Felle.
Anfang der achtziger Jahre machten die „Lounge Lizards“ mit ihrem Frontman John Lurie auf Jazzfestivals Furore, unter anderem in Berlin. Spielen konnten sie nicht sonderlich virtuos, aber ihre „Message“ begeisterte das Publikum. Mit schwermütig aggressivem Sound zelebrierten sie alte Standards. Ihr lässiges Auftreten und der unverwechselbare Klang wurden zu Markenzeichen. Schnell galten sie in Jazzkreisen als die „hippeste“ Combo weit und breit.
Was hat John Lurie so „hip“ gemacht?
Eine gute Frage, aber wen interessiert schon seine Biographie? Folgen wir lieber seiner Legende: Nach dem Tod des Vaters verließ er die Schule und streunte deprimiert durch die nächtlichen Straßen von Minneapolis. Irgendwann schenkte ihm jemand ein Saxophon, und wohl nur, um anders zu sein, wendete sich der Außenseiter dem Jazz zu und nicht dem Rock n Roll. Er hörte stapelweise Schallplatten von Ellington bis Coltrane. Diese Musik gab ihm Halt im Durcheinander seines Lebens. Fortan stromerte er durch die Weltgeschichte, nahm zeitweise Drogen, lebte in einer Yoga Kommune und landete schließlich im Gefolge einer Tänzerin im New Yorker East Village. Das war Ende der Sechziger, die Zeit der Happenings, der be ins, der love ins.
Lurie schlägt sich durch in der Boheme New Yorks, arbeitet dies und das, versucht sich als Performance Künstler, bis er irgendwann auf den Film kommt. Um das nötige Geld dafür einzuspielen, gründet er mit seinem Bruder Evan eine Band. Der Name entspricht seinem Stand: The Lounge Lizards, die „Salonlöwen“. Der Film wird gedreht, aber die Band läuft besser. Das lag vor allen Dingen am Konzept: alter Jazz, gepaart mit der Urgewalt des Punks, hypercool präsentiert von Schlipsträgern in weiten Anzügen. Sie waren also nicht irgendwelche Jazzer, sondern boten einen speziellen Sound, ein Aussehen und eine Art Weltanschauung. Und so wurden bereits zu Beginn dieses Jahrzehnts Lounge Lizards Platten in den Szenekellern der Welt ehrfürchtig aufgelegt.
Richtig bekannt ist Lurie allerdings als Filmschauspieler geworden, mit Stranger than Paradise und Down by Law. Die Filme kreieren aus den Banalitäten des kaputten Alltags eine schaurig schöne Welt, die sich perfekt spiegelt in John Luries Gesicht: kantig, männlich, herbe. Unnahbar zu sein, auch ein wenig unverstanden — damit muss Luries Aufstieg zum Kultstar zu tun haben. So ein bisschen James Dean der achtziger Jahre.
Seine diesjährige Welttournee hat John Lurie mit den Lounge Lizards nun wieder einmal nach Deutschland gebracht (noch bis zum 21. Juli). Am Tag vor seinem Konzert in Berlin zeigte das Kino „Arsenal“ drei Filme mit und ein Video von ihm. Er selbst erschien dann auch noch zum Small talk.
Wie er nun dasteht, im grauen Anzug, mit grauen Schuhen und roter Krawatte, wirkt er vor allem auf Frauen. Die Beine überkreuzt steht er da, Hände in den Hosentaschen, und läßt den Kopf genauso giraffenartig hängen wie der Willie in „Stranger than Paradise“, als der seiner geliebten Cousine völlig unbeholfen (aber cool!) ein entsetzliches Kleid schenkt.
Lurie schrieb das Drehbuch zur Hälfte, und das merkt man: Ohne ihn wäre der Film unvorstellbar.
Im Kino antwortet er mal höflich, mal frech auf die Fragen und ist vor allen Dingen „obercool“. Kein Zweifel: Man muss sich ihm stellen, auf Bühne, Platte oder Leinwand, er ist keine Type, er ist hundertprozentig er selber. Gegenüber den ständigen Unsicherheiten in unserer modernen Welt wirkt seine ausgestellte Souveränität beinahe wie ein Heiligenschein auf die Angepassten, die Wohlstandskids, die Studenten — glückselige Fans, Aug in Aug mit ihrem Idol!
Und dann, im „Metropol“, das Berliner Konzert. John Lurie, in hellem Anzug, Hände wieder in den Hosentaschen, wartet — wahrscheinlich darauf, daß ihn die Muse küßt. Dann beginnt er mit leisen Saxophonlinien. Geschmackvolle Akkordphrasierungen der Gitarren: Bass und Schlagzeug passen sich der Weite des Klanges an. Es klingt wie Filmmusik, was nicht verwunderlich ist, schrieb er doch viele Soundtracks, nicht nur für die Filme, in denen er mitspielte „One, two, three, four“ ruft er, und die Band knallt los, Harmonien von den Bläsern, und darüber quäkt er, immer noch cool, nur ist sein Kopf jetzt etwas gerötet. Ein kakophonischer Break, alle schreien in die Mikros, sehr frei setzen Posaune und der zweite Saxophonist ein. Es dröhnt, scheppert, gellt und hupt aus allen Ecken.
Plötzlich ein Aufbäumen der Posaune, und aus der Großstadtsymphonie schält sich ein „Dschungelrhythmus“. Im schmetternden Sound der Rüsselschwinger ein jazziges Solo des Posaunisten. Beim Höhepunkt blöken die beiden Saxophone los, und nahtlos geht die Handlung am Klavier weiter, Evan Lurie haut alle nur erdenklichen falschen Töne aus den Tasten, und der Gitarrist schmust in Heavy Metal Manier durch die Harmonien. Lurie setzt dann noch mal nach mit balinesischen Phrasierungen. Dschungel und Großstadt werden eins.
Dann kommen die Balladen, viele mit der klagenden Direktheit einer Charlie Mingus Komposition. Triolisch hangelt sich Lurie durch das dürre Songgerüst, mit schmauchig rauchigem Ton, und verzaubert das „Metropol“ in einen Salon. Virtuoser sind andere, so faszinierend wenige, aber so „hip“ kaum welche.
Hingerissen sind seine Fans. Lurie ist ein Kultstar. Und sie dürfen dabeisein. Da kommt Sinn ins Leben.
Erschienen in: Die Zeit 16.6.89