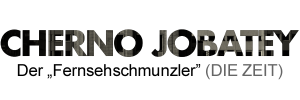Wie viel Digitalisierung verträgt Kultur?
Digitalisierung ist ein Segen der Menschheit, bringt uns eine nie gekannte Vielfalt, wir können alles sehen, lesen, erlernen, sie macht die Welt kleiner und demokratischer. Trotz dieser Heilsversprechen macht sich gerade bei Kulturschaffenden eine Skepsis breit. Immer hörbarer steht eine Frage im Raum: Wie viel Digitalisierung verträgt Kultur, oder besser wie viel Digitalisierung verträgt der Kulturbeatrieb?
Ist Digitalisierung nun ein Segen oder nichts weiter als eine gigantische Enteignungsmaschine, wie manche befürchten? Wie sollen wir damit umgehen? Diskussionsstoff für die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und Popstar Smudo von den Fantastischen Vier.
Hauptsächlich geht es darum, dass Künstler für ihr Werk fair entlohnt werden: schlicht davon leben können. Die frühere Financiersrolle der Mäzene – meist Kirchen- oder weltliche Fürsten – übernahm in moderneren Zeiten eine Kombination aus Urheber- und Leistungsschutzrecht und Abgaben. Was nach Alter Väter Sitte reibungslos rollte, rumpelt und schlittert nun vielfach.
Neues, angepasstes Recht
Neue Technologien bringen neue Möglichkeiten und diese bedürfen früher oder später angepasste Regeln. Brauchen wir neue gesetzliche Regulierungen? Was würden die bewirken? Gerade Urheber- und Leistungsschutzrecht regelt jedes Land, auch innerhalb Europas anders. Was würde also ein neues Recht bewirken, wenn eine Firma, die ein Produkt für den deutschen Markt anbietet, in Luxemburg beheimatet ist, oder in Irland, oder in Neuseeland oder den USA? Oder in einem Land, in dem es überhaupt kein Urheberrecht gibt? Gibt es da überhaupt eine Lösung? Und wäre die dann auch durchsetzbar?
Digitalisierung metzelt Musik
Die erste Kulturform, die die Digitalisierung „erwischte“, war Musik. Es traf die Musikindustrie oder genauer – die Tonträgerindustrie völlig unvorbereitet. Kompressionsverfahren wie mp3 dampften große Musikdateien ein. Jeder konnte Musik tauschen und verteilen. Die Tauschbörse Napster steht für das Wanken einer ganzen Kulturform. Umsätze der Industrie und der Musiker brachen weg.
Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen, die Branche hat gelernt, und lebt mittlerweile ganz gut mit den (eigentlich nicht mehr ganz so) neuen Technologien.
Von Musik lernen?
Wurde die Musik damals von den Gesetzgebern im Stich gelassen, die das Urheberrecht einfach nicht schnell genug angepasst haben? Oder haben die Konzerne den Wechsel verschlafen? Und wenn ja wohin? Wo soll der Schwerpunkt liegen? Bei den Künstlern, oder eher wie es jetzt laut einer Studie der Fall zu sein scheint bei der Tonträgerindustrie?
Filmförderung verringert sich durch Digitalisierung
Wenigen ist bewusst, dass durch das digitalisierte Konsumentenverhalten Kulturabgaben ins Schleudern geraten: da wir, lieber Filme gestreamt auf dem Handy oder dem heimischen Großbildschirm sehen, und weniger ins Kino gehen, ist die Summe der Abgabe, die etwa auf der Kinokarte war, und Filme finanziert hat, immer kleiner geworden. Ein wesentlicher Teil staatlicher Film-Fördermittel stammt aus Abgaben rund um Filme. Netflix, iTunes und Co führen zur Verschiebung von Umsätzen vom Kino ins Netz.
Wie die Förderlücke füllen?
Da Betreiber von Streamingdiensten häufig für deutsche Gesetze unerreichbar im Ausland sitzen, wird darüber diskutiert, Internetzugangsanbieter, die Streaming durch ihre Leitungen ermöglichen, in die Pflicht zu nehmen. Wäre das fair? Hat man da alle Interessen im Blick, also die der Künstler, der Netzbetreiber und die von uns Konsumenten?
Pessimistisch oder optimistisch?
Bei all den komplexen Zusammenhängen muss man doch sagen, das für Pessimismus nicht so viel Grundlage besteht: Konzerte sind voll, Museen vermelden Rekorde. Kann es sein, das die ständige Verfügbarkeit und Abbildung von Kunst zu einem Hunger auf Originales führt? Hilft Digitalisierung letztendlich Künstlern, die ihr „Geschäftsmodell“ nur den neuen Realitäten anpassen müssen?